Suche

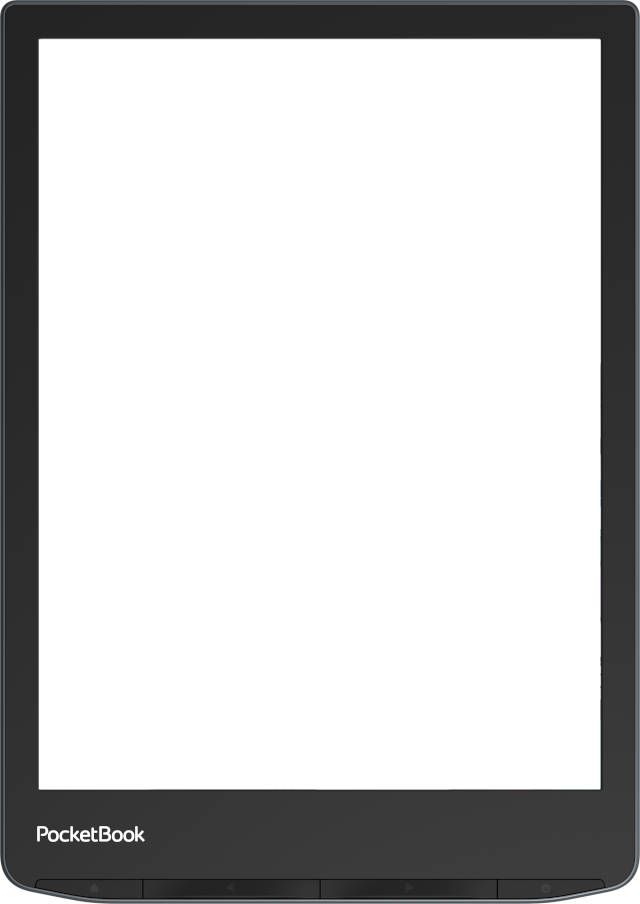
Panikrocker küsst man nicht
Wie mich die wilde Liebe zu Udo Lindenberg ins Leben katapultierte | Maria Bachmann
E-Book (EPUB)
2020 Goldmann Verlag
256 Seiten
ISBN: 978-3-641-26656-1
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Taschenbuch erhältlich
»Maria war damals schon 'ne Schlau-Frau, erst 'n bisschen schüchtern vom Kartoffelacker in die Großstadt, künstlerisch, immer neugierig auf die Wundertüte des Lebens. Heute gibt sie den Leuten viel Energy, Fraktion ?Durchblick und Unbescheidenheit?. Coole Compagnera mit Seelen-Tieftaucher-Lizenz und Abenteuergeist. Das brauchen wir heute.« Udo Lindenberg
Mitte der Achtzigerjahre in der deutschen Provinz: Die junge Krankenschwester Maria sehnt sich nach einem Leben voller Freiheit und Erfüllung. Als sie auf einem Konzert Udo Lindenberg kennenlernt, landet sie erst im Tourbus der Band, dann in seinen Armen. Schnell erliegt sie dem rebellischen, wilden und kompromisslosen Charme des »Panikrockers«. Doch es knirscht zwischen ihnen, und während sie vom Ankommen träumt, will er radikale Unabhängigkeit. Maria braucht Jahre und viele schöne, aber auch schmerzliche Erfahrungen, bis sie sich von ihm löst und ihren eigenen Weg findet. In der aktualisierten Neuauflage dieses 1992 erstmalig erschienenen Buches erzählt die bekannte Schauspielerin und Autorin Maria Bachmann eindrucksvoll und inspirierend die leidenschaftliche Geschichte einer lebenshungrigen Frau, die ausbricht und erst Udo Lindenberg, dann die große weite Welt und schließlich ihr eigenes Leben erobert.
Die Schauspielerin und Autorin Maria Bachmann ist seit 1993 einem großen Publikum aus zahlreichen Kino- und TV-Produktionen bekannt. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie Trainerin für persönlichen Ausdruck und Präsenz und unterstützt Menschen dabei, ihre wahre Motivation zu finden. Mit ihrem letzten Buch »Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast« stand sie auf der Spiegel-Bestsellerliste. Maria Bachmann lebt in München.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Ich stehe fast während der ganzen Frühschicht im »Ausguss«. Das ist der Raum, den man nur betritt, wenn es unbedingt sein muss, um die vollgepissten Bettpfannen zu desinfizieren oder die vielen Blumen der Patienten auszusortieren. Was noch nicht verwelkt ist, kommt zurück in die Vase. Auch wenn's ein bisschen mickrig aussieht: zwei einzelne Blütenstängel. Ich zähle die Stunden bis zur Übergabe. Wenn die gelben Lampen über den Türen aufleuchten, gehe ich in die Krankenzimmer, auch das ist mein Job. Zu manchen Patienten geh ich sehr gern. Die nennen mich »ihren Sonnenschein«. Ich muntere sie auf, hole ihnen Tee oder gehe mit ihnen auf dem sterilen, weißen Gang spazieren. Dafür ist aber wenig Zeit. Bei den Schwerkranken gebe ich mir jedes Mal vor der Tür einen Ruck. Vielleicht bin ich tatsächlich zu zart für diesen Beruf, was viele schon von mir behauptet haben. Ich kann zumindest nicht sachlich und nüchtern mit den Kranken umgehen. Da schwingt immer noch etwas anderes mit, eine Ahnung dessen, was sie vielleicht wirklich wollen: eine Umarmung, Ruhe, ein ehrlich gemeintes Lachen, sterben können, Verständnis. Ich habe Angst, diesem Sog, der aus einem einzigen unausgesprochenen »Hilfe« besteht und mich erfasst, sobald ich nur die Tür aufmache, überwältigt zu werden. Ich wünschte, ich wäre professioneller, robuster, und hätte meine Gefühle mehr im Griff. Der weiße Kittel ist zwar ein Schutz, aber er ist dünn.
Frau Schneider hat Dünndarmkrebs. Sie kann nicht mehr essen. Auch nicht, wenn ich sie füttere. Ich sitze an ihrem Bett und sehe ab und zu auf die Parkanlagen mit den Hagebuttensträuchern am Wegrand. Einige Patienten gehen in Bademantel und Schal spazieren. Ein warmer Aprilmorgen.
»Ich hab gar kein Appetit, Schwester ...« - »Aber ein bisschen können Sie bestimmt noch ...« Ich weiß, dass sie nicht mehr kann. Ihre knochige Hand krallt sich in meiner fest: »Ich möcht sterbe, des is kei Lebe!« Sie lässt mich nicht los, und ich sterbe von der Hand aufwärts bis zum Ellenbogen ein bisschen mit ihr. Am liebsten rauslaufen, sie ihrem Leiden überlassen, ihrem Kot, in dem sie oft liegt. Was weiß ich schon vom Sterben? Ich weiß ja noch nicht mal was vom Leben. Das alles denke ich in Sekundenschnelle, und dabei möchte ich sie um Entschuldigung bitten. Das passiert mir immer wieder. Ich mag sie doch, Frau Schneider, die liebe Frau Schneider, die mir immer ihren Nachtisch aufhob, als sie noch selbstständig essen konnte, ihn im Nachtschränkchen versteckte und ihn rausholte, wenn wir allein im Zimmer waren. Die Zeit ist lange vorbei. Jetzt ist Sterbenszeit. »Wissen Sie was, Schwester«, reißt sie mich aus meinen Gedanken, »... ich hätt gern was zu trinken.« Ich bringe ihr Kamillentee. Sie ist dankbar, und ich schäme mich. Weil es so wenig ist, was ich ihr gebe, und sie sich so sehr darüber freut. Ich kann doch in diesem Job nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen? Tue ich nicht das, was alle anderen auch tun? Ich gehe zurück zum »Ausguss« und sortiere die Blumen weiter, umnebelt von Sagrotanspray und dem beißenden Uringeruch aus Zimmer 52.
Ich sollte diese Arbeit lieben! Aber jeden Tag gehe ich unzufrieden von Station. Ich schäme mich vor mir selbst. Ich vermisse die Leidenschaft in fast allem, was ich tue. Dafür sind die Momente, in denen sie aufflammt, geradezu heilig. Wenn ich tanze. Wenn ich »Forever young« höre. Wenn ich Tagebuch schreibe. Wieder leuchtet das Licht über dem Zimmer von Frau Schneider. »Gehn Sie, Schwester Maria? Nehmen Sie Waschzeug mit.« Die Kollegin klingt tonlos. Als habe sie schon viele Leichen gesehen. »Ja«, sage ich und öffne die Tür. Es stinkt erbärmlich nach Kot. Im selben Moment, da der Gestank in meine Nase dringt, sehe ich die Glasscherben auf dem Boden. »Ich hab's nur nehmen wolle, i kann net ...« Ihre Augen werden nass und suchen einen Fixpunkt an der Zimmerdecke. »Ist ja gut, Frau Schneider, ich mach das schon.« De
