Suche

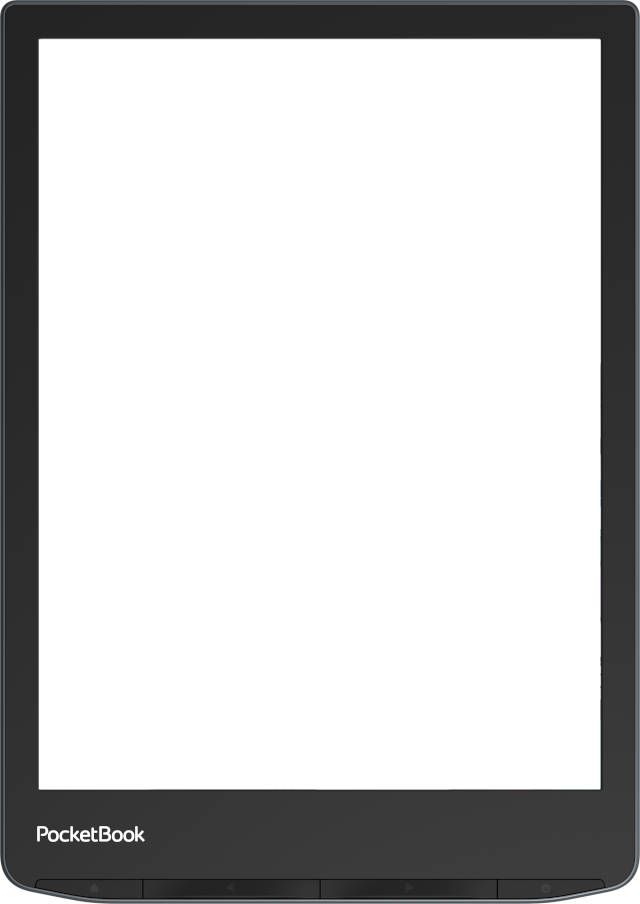
Paula oder Die sieben Farben der Einsamkeit
Roman | Stephan Abarbanell
E-Book (EPUB)
2024 Karl Blessing Verlag
240 Seiten
ISBN: 978-3-641-31547-4
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich
Sie wollte einen Mann heiraten und bekam einen Staat. Paula Munweis wurde als junges Mädchen aus Minsk nach New York geschickt, träumte von einem Medizinstudium, war überzeugte Anarchistin. Doch dann traf sie ihren Ehemann, den Gründer des Staates Israel David Ben-Gurion. An ihrem Lebensabend zieht sie widerstrebend mit ihm in einen Kibbuz in der Wüste Negev. Mai 1966: Am kommenden Tag erwartet Ben-Gurion einen späten Freund, den vor Kurzem aus dem Amt geschiedenen Konrad Adenauer. Und wieder einmal ist es an Paula, diesen Besuch auszurichten und zu gestalten.
Armut, Kriege, Mutterschaft und immer wieder Einsamkeit: Dieser Roman erzählt die Geschichte einer starken, mutigen Frau, der das Leben viele Kompromisse abverlangt und sie zur Frau des Staatsgründers eines Landes gemacht hat, an das sie nicht glaubte. Am Ende ihres Lebens bricht sie noch einmal auf, um sich selbst zu finden.
Stephan Abarbanell, 1957 geboren, wuchs in Hamburg auf. Er studierte Evangelische Theologie sowie Allgemeine Rhetorik in Hamburg, Tübingen und Berkeley und war viele Jahre lang Kulturchef des rbb. Sein Romandebüt, »Morgenland«, erschien 2015 bei Blessing, 2019 folgte »Das Licht jener Tage« und 2022 »10 Uhr 50, Grunewald«. Stephan Abarbanell lebt mit seiner Frau, der Übersetzerin Bettina Abarbanell, in Potsdam-Babelsberg.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
In den Morgenstunden schlugen die Hunde an.
»Das war's«, sagte sie.
Es müsste ein Wunder geschehen, damit sie noch einmal in den Schlaf finden würde.
Aber Wunder gab es nicht. Oder ihre Zeit war abgelaufen. Sie hatte es nur zu spät bemerkt.
Sie sank zurück auf die Kissen und lauschte. Mit einem Quietschen öffnete sich die Fliegentür, fiel, wumms, zurück ins Schloss. Auch ihn hatten die Hunde geweckt. Seit sie denken konnte, hatten sie und ihr Mann getrennte Schlafzimmer, ob in der Stadt oder hier am Ende der Welt.
Sie sah ihn vor sich, wie er vor dem Haus unter dem Wüstenhimmel stand, die schlackernden Gummistiefel an seinen nackten Füßen, das Hemd über der Hose, die Haare links und rechts am Kopf bettzauselig in die Höhe ragend, ein Wald voll weißer Antennen (wenn es denn so etwas gäbe). Das blauschwarze Firmament und der Schattenriss der fernen Berge machten ihn noch kleiner, als er ohnehin schon war.
Manchmal tat er ihr leid. Eine Empfindung, die er als unpolitische Gefühlsduselei abgetan hätte.
»Die Zeiten, in denen Juden auf das Mitleid anderer angewiesen waren, sind ein für alle Mal vorbei«, hätte er gesagt, für einen Moment wieder ganz der Staatsmann.
Noch war es dunkel. Unter der im Mondlicht schimmernden Glasplatte des Tisches hatte sie die Bilder ihrer Liebsten ausgelegt, ihre Tochter Geula, ihr Sohn Amos (einmal als Baby, einmal in Uniform) und die Jüngste, Renana, alle in Schwarz-Weiß. Dazu die Enkel.
Als würden die Lebenden eine Tote bewachen, hatte sie einmal zu Amos gesagt und sich über die Bitterkeit in ihrer Stimme gewundert. Oder als müsse sie sich beim Erwachen jeden Tag wieder vergewissern, dass es ein Leben mitten im Leben einmal gegeben hatte. Auch für sie.
Einen Schrank, einen Tisch, zwei kleine (eigentlich nie genutzte) Sessel und das Bett hatte sie in ihrem Zimmer zugelassen. Und einen alten, durch viele Leben mitgeschleppten halbseitig aufklappbaren Frisiertisch mit greisenhaft dünnen Beinen, der in dem kleinen Raum einen letzten Auftrag als Nachttisch übernommen hatte, Tag und Nacht in weltvergessener Untätigkeit neben ihrem Bett verharrend. Ein Privileg, das sie nur den Dingen zugestehen konnte, niemals sich selbst. So alt sie auch war.
Das Haus eine Hütte aus Holz, umgeben von der Wüste und dem weiten, schattenlosen Land. In den Nächten, wenn die Hunde am Rande des Kibbuz schliefen, spürte sie die Stille wie eine kalte Hand auf ihrer Haut.
Sie tastete durch das Dunkel nach der schweren schwarzen Brille, bekam sie zu fassen, schob sie sich auf die Nase.
»Sehen aus wie zwei beschwipste Quallen im Toten Meer«, hatte sie einmal zu Geula gesagt und vor dem Spiegel ihre Augen hinter den dicken Gläsern betrachtet. Wenige Wochen vor ihrem siebzigsten Geburtstag, als es ihr noch besser ging oder sie sich es zumindest noch einreden konnte.
»Ima, im Toten Meer gibt es keine Quallen«, hatte ihre Tochter geantwortet.
»Dann eben das Schwarze Meer, wenn dir das so wichtig ist.«
Die phosphorgrünen Finger über den matt leuchtenden Ziffern des Weckers salutierten, meldeten kurz nach vier. Es war Mai, und doch waren die Nächte kühl, ein Fuß lugte unter der Decke hervor, sie zog ihn zurück in die schützende Höhle.
Von den Hunden kam nur noch ein Jaulen. Meist waren es ohnehin nur sich der Siedlung nähernde, Nahrung witternde Schakale, die die Hunde anschlagen ließen.
Die jungen Leute würden weiterschlafen in ihrer aus dünnwandigen Hütten zusammengehämmerten Siedlung, von der aus sie die den Kibbuz umgebende Wüste in ein Eden verwandeln wollten. Neues, fruchtbares Land sollte unter ihren Händen entstehen, der Natur abgerungen. Und sie mitten unter ihnen.
Sie hatte mit dieser letzten Wendung ihres L
